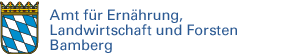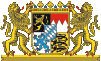Initiative Zukunftswald am AELF Bamberg
Alternative Baumarten – sinnvolle Ergänzung beim Waldumbau

Foto: Gregor Schießl
Durch einen Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen im Zuge des Klimawandels verschieben sich die Verbreitungsschwerpunkte vieler mitteleuropäischer Baumarten. Der Anteil an Baumarten, die höhere Temperaturen und geringere Niederschläge tolerieren, wird steigen.
Alternative Baumarten
Stabilität der Wälder wird erhöht
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Foto: Tobias Hase/StMELF
Kriterien für den Anbau
Empfehlungen für bestimmte Baumarten
Folgende Baumarten können auf geeigneten Standorten als anbaufähig und -würdig empfohlen werden:
- Schwarzkiefer (Pinus nigra div. Var.), insb. Die Varietäten aus Kalabrien, Korsika und Österreich
- Grüne Douglasie (Pseudotsuga menziesii var. Viridis)
- Große Küstentanne (Abies grandis)
- Japanische Lärche (Larix kaemperii)
- Hybridlärche (Larix x eurolepis)
- Robinie (Robinia pseudoacacia)
- Schwarznuss (Juglans nigra)
- Roteiche (Qercus ruba)
- Hybridnuss (Juglans x intermedia)
Förderung von Anbau zu Testzwecken
Testanbauten folgender Arten können deshalb finanziell gefördert werden:
- Atlaszeder (Cedrus atlantica)
- Libanonzeder (Cedrus libani)
- Türkische Tanne (Abies bornmuelleriana)
- Baumhasel (Türkei) (Corylus colurna)
Weitere Informationen
Alternativbaumarten für Praxisanbauversuche in Bayern - Amt für Waldgenetik ![]()
Bestände alternativer Baumarten im Amtsbereich
Waldumbau Burg Feuerstein
Seltene heimische Baumarten
Die regelmäßige Förderung standortgerechter Baumarten erhöht stetig den Laubholzanteil im Wald um die Burg Feuerstein.
Einbringung alternativer Baumarten
Pflegeziele des Waldumbaus
Waldumbau im Klimawandel
Weitere Hinweise
Anfahrt
direkt in den Wald.
Die vielen Baumarten befinden sich auf den Weg rund um die Burg.
- Wuchsgebiet:
- Frankenalb und Oberpfälzer Jura
- Nördliche Frankenalb
- Jahresdurchschnitt – Temperatur:
- 7 – 8 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschlag:
- 850 – 900 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Orchideen-Buchenwald
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Malms
- Mergel, Kalk, und Dolomitstein
- Kalkverwitterungslehm
- Nährstoffversorgung:
- gut basengesättigt
- Wasserversorgung:
- mäßig frisch bis trocken
- Begründung:
- um 1900
- Oberschicht:
- Kiefer, Buche
- Unterschicht:
- Eiche, Esche, Ulme, Kirsche, sonst. Edellaubholz
- Sonst. eingebrachte Baumarten:
- Douglasie, Schwarzkiefer, Zeder
- Flächengröße:
- 38 ha
- Pflanzverband :
- Naturwald
- Mischungsform:
- Bestandsweise
- Anstehende Maßnahmen:
- stetige Verjüngung, Entnahme der Überhälter
Baumartenreiche Erstaufforstung: Von der Elsbeere bis zum Mammutbaum
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Mammutbaum und Thuja;
Foto David Schwarzmann
Pflanzung und Pflege
Anfahrtsbeschreibung
Auf halber Strecke biegen rechts nach Veilbronn ab.
In Veilbronn, die erste rechts abbiegen nach Störnhof.
Auf dem Plateau (wo der Wald aufhört) ist auf der rechten Seite die Erstaufforstung mit ca. 30 verschiedenen Baumarten.
- Wuchsgebiet:
- Frankenalb und Oberpfälzer Jura
- Jahresdurchschnitt-Temperatur
- 7,5 – 8 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschlag:
- 850 – 900 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Buchen dominierte Wälder
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Malms
- Mergel, Kalk, und Dolomitstein
- Oberboden:
- milder Ton
- Unterboden:
- Lehm
- Nährstoffversorgung:
- gut
- Wasserversorgung:
- mäßig frisch bis trocken
Kulturfläche mit 33 verschiedenen Baumarten
- Begründung:
- 2011
- Pflanzung von:
- Lärche, Bergahorn, Kastanie, Kirsche, Elsbeere in Mischung mit Winderlinde und Hainbuche
- Bergmammut, Schwarzkiefer, Wildbirne und Lärche in truppweiser Mischung
- Flächengröße:
- 3,0 ha
- Pflanzverband:
- 2 m x 1,5 m
- Mischungsform:
- gruppenweise und Einzelmischung
Aufforstung mit Baumhasel und Edelkastanie
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Foto: David Schwarzmann
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Baumhaselnüsse;
Foto: Gregor Schießl
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Baumhaselpflanzung;
Foto: Tobias Haase
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Erntereifer Baumhasel;
Foto Gregor Schießl
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Edelkastanie;
Foto David Schwarzmann
Warum alternative Baumarten
Weitere Hinweise
Im Ort Tüngbach biegen Sie in der scharfen Rechtskurve links in den „Waldweg“ ab.
Nach dem letzten Haus auf der linken Seite befindet sich der Erstaufforstungsbestand mit Baumhasel und Edelkastanie.
- Wuchsgebiet:
- Fränkischer Keuper und Albvorland
- Jahresdurchschnitt – Temperatur:
- 7 – 8 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschläge:
- 600 – 700 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Buchen dominierte Wälder mit Eiche und Hainbuche
- Ausgangsgestein:
- Sandstein - Tonstein - Wechselfolge, mit Dolomiteinlagen
- Boden:
- Feinsandige Lehmauflage mit Ton im Unterboden
- Nährstoffversorgung:
- gut
- Wasserversorgung:
- mäßig frisch bis mäßig trocken
- Begründung:
- im Herbst 2017
- Pflanzung von:
- Edelkastanie, Eiche, Hainbuche
- Baumhasel, Hainbuche
- Eiche, Elsbeere, Speierling, Hainbuche
- Flächengröße:
- 0,2 ha
- Pflanzverband:
- 2 m x 1,5 m
- Mischungsform:
- einzeln
- Bisher erfolgte Eingriffe:
- Nachbesserung einzelner Pflanzen 2018/2019
- Zwieselschnitt Ausgrasen, mehrmals im Jahr
Robinie in Nachbarschaft zum Eichen-Hainbuchenwald
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Robinienblüten;
Foto: B. Meyer-Münzer, LWF
Zu Ihren Charaktereigenschaften zählen das dauerhafte Holz, die reiche Blüte (Akazienhonig) und die Fähigkeit Luftstickstoff zu binden.
Bewirtschaftung und Pflege
Die Bürgerspitalstiftung verkauft das Holz an ein Unternehmen, das mit dem äußerst witterungsbeständigen Robinienholz Konstruktionsholz für Spielplätze und Terrassen herstellt.
Warum Robinie?
Weitere Hinweise
Anfahrtsbeschreibung
- Wuchsgebiet:
- Fränkischer Keuper und Albvorland
- Jahresdurchschnitt – Temperatur:
- 8 – 9 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschlag:
- 700 – 750 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Rhäts und des Feuerletten
- Boden:
- tonig, lehmige Böden mit Sandeinlagen
- Oberboden:
- Lehm
- Unterboden:
- z.T. schwere Tonschichten
- Nährstoffversorgung:
- mittel
- Wasserversorgung:
- mäßig frisch
Eichenwald mit Robinie
- Begründungszeit:
- Hauptbaumarten:
- unbekannt
- Nebenbaumarten:
- Eiche, Robinie
- Flächengröße:
- Hainbuche, Linde, Kirsche, Elsbeere
- Mischungsform:
- 30 ha
- Bewirtschaftungsweise:
- Dem naturnahen Eichenwald, einzeln beigemischte Robinie, aus Stockausschlag, Wurzelbrut und Samen
Die Elsbeere – Wald auf problematischem Tonboden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Elsbeerblätter;
Foto: David Schwarzmann
Bei näherem Hinsehen finden sich sogar Wildäpfel und Wildbirnen in der Baumartenzusammensetzung. Die Waldgesellschaft ist ein Refugium für selten gewordene Tier- und vor allem Pflanzenarten.
Im Elsbeerenwald bei Bräunigshof
Warum Elsbeere?
Weitere Hinweise
In Bubenreuth (nach der Bahnunterführung) biegen Sie bei der ersten Kreuzung links in die Scherleshofer Straße Richtung Igelsdorf ab.
Nach dem Sportplatz (auf der linken Seite) kommt auf der rechten Seite ein geschotterter Feldweg.
Dort parken Sie.
Nach ca. 200 m kommt ein Schild auf der linken Seite.
Dort beginnt der Weg durch den Elsbeerenwald.
- Wuchsgebiet:
- Fränkischer Keuper und Albvorland
- Jahresdurchschnitt-Temperatur:
- 8,5 – 9 °C
- Jahresdurchschnitt-Niederschlag
- 650 – 700 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Eiche-Hainbuchen-Trockenwald
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Rhäts und des Feuerletten
- Tonstein mit Dolomit und Sandsteineinlagerungen
- Boden:
- schwerer Tonboden
- Nährstoffversorgung:
- gut
- Wasserversorgung:
- mäßig frisch bis wechseltrocken
Eichenwald mit hohem Elsbeeren-Anteil
- Hauptbaumarten:
- Nebenbaumarten:
- Eiche, Kiefer, Elsbeere
- Flächengröße:
- Linde, Kirsche, Feldahorn, Wildobst
- Mischungsform:
- 6 ha
- Kürzlich erfolgte Eingriffe:
- Elsbeere flächig vertreten zum Teil als führende Baumart
Edelkastanie – eine klimatolerante Ergänzung
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Esskastanienfrucht;
Foto: Gregor Schießl
Pflanzung und Pflege
Der Bestand verfügt über eine ausreichende Anzahl gut geformter Einzelbäume.
In Zukunft muss den geasteten Bäumen durch Entnahme bedrängender Nachbarbäume ausreichend Standraum gegeben werden.
Warum Edelkastanie?
interessanten Baumart.
Weitere Hinweise
In Letten biegen Sie links in die Letten (Straßenname) Richtung Bodengrub ab.
In der scharfen Rechtskurve (im Wald) vor Bodengrub suchen Sie sich einen Parkplatz.
Dann gehen Sie gerade aus und biegen rechts in den ersten Forstweg ein.
Dort beginnt aus der linken Seite der Edelkastanienwald.
- Wuchsgebiet:
- Frankenalb und Oberpfälzer Jura
- Jahresdurchschnitt-Temperatur:
- 7,5 – 8,5 °C
- Jahresdurchschnitt- Niederschlag:
- 850 – 900 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- zählt zu den Hainsimsen Buchenwäldern, im Übergang zum Waldmeister Buchenwald
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Doggers
- Tonstein, Sandstein mit Eisenerzflözen
- Bodenart:
- lehmiger Sand des Eisensandsteins
- Nährstoffversorgung:
- mäßig
- Wasserversorgung:
- gut
Edelkastanien-Jungwald im Mischwald
- Begründung:
- Pflanzung von:
- 2008
- Flächengröße:
- 300 Stk. Spitzahorn
- Pflanzverband:
- 0,1 ha
- Mischungsform:
- 2 m x 1,5 m
- Anstehende Maßnahmen:
- Pflanzung im Trupp auf 300 qm
Die Roteichen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Roteichenblätter;
Foto David Schwarzmann
Roteiche in Baumholzstärke - Regnitzsenke
Anfahrt
Die Maximilianstraße geht dann in die Luitpoldstraße über.
Nach der Überquerung des Main-Donau-Kanal biegen Sie rechts in die Alleestraße ab.
Sie folgen der Alleestraße bis zu der T-Kreuzung am Main-Donau-Kanal.
Sie biegen links in die Werksstraße ein.
Sie folgen der Werksstr. bis zur Brücke, die zum Kraftwerk führt.
Dort suchen sie sich einen Parkplatz.
Sie gehen ca. 50 m auf den Waldweg in süd-westliche Richtung, dort befindet sich der Roteichenbestand.
- Wuchsgebiet :
- Fränkischer Keuper und Albvorland
- Jahresdurchschnitt - Temperatur:
- 8 – 9 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschläge:
- 500 – 600 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Laubholz Mischbestand in der Hartholzaue, mit Roteiche als führende Baumart
- Ausgangsgestein:
- Substrate nordbayerischer Terrassenablagerungen
- Boden :
- Sand mit geringen Tonanteil
- Nährstoffversorgung:
- mittel bis mäßig
- Wasserversorgung :
- mäßig frisch bis mäßig trocken
Roteiche im Mischwald als führende Baumart
- Begründung :
- Hauptbaumart
- vor ca. 60 Jahren
- Nebenbaumarten
- Roteiche
- Mittlere Höhe:
- Kiefer, Buche, Eiche, Kirsche
- Flächengröße:
- 25 m
- Mittlerer Brusthöhendurchmesser:
- ca. 7 ha
- Mischungsform
- 25 cm
- Anstehende Maßnahmen:
- auf der gesamten Fläche einzeln beigemischt
Durchforstungsmaßnahme im Altholz - Hundshaupten
Warum Roteiche?
Weitere Hinweise
Anfahrt
Kurz vor Ortsende (Egloffsteinerhüll) geht eine geteerte Straße nach rechts ab.
Sie biegen aber in den gegenüberliegenden Wirtschaftsweg (nach Norden) ein!
Und folgen den Weg bis zum Wald.
Dort parken Sie.
- Wuchsgebiet
- Frankenalb und Oberpfälzer Jura
- Jahresdurchschnitt – Temperatur:
- 7 – 8 °C
- Jahresdurchschnitt – Niederschlag:
- 900 – 950 mm
- Potenziell natürliche Waldgesellschaft:
- Buchen dominierte Wälder
- Ausgangsgestein:
- Substrate des Malms
- Mergel, Kalk, und Dolomitstein
- Oberboden:
- milder Ton
- Unterboden:
- Lehmiger Sand
- Nährstoffversorgung:
- gut basengesättigt
- Wasserversorgung:
- gut
- Hauptbaumarten:
- Roteiche, Buche
- Nebenbaumarten:
- Fichte, Lärche, Kiefer
- Flächengröße:
- 2,6 ha
- Mischungsform:
- Gruppe Roteiche im Altholzstadium
- Anstehende Maßnahmen:
- Verjüngungsmaßnahme
Allgemeine Hinweise für Ihren Besuch
Das Betreten der Waldbestände erfolgt auf eigene Gefahr.
Es erfolgen keine Sicherungsmaßnahmen gegenüber typischen Waldgefahren, die sich aus der Natur oder der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ergeben.
Vermeiden Sie es, die Bestände während und nach Stürmen oder anderen markanten Wetterlagen zu betreten, da dann eine große Gefahr durch herabfallende Äste oder Baumteile besteht.
Bitte achten Sie auch auf festes Schuhwerk, da es sich um unwegsames Gelände handeln kann und hinterlassen Sie den Wald so, wie Sie sich auch Ihren eigenen Wald wünschen (Müll bitte mitnehmen).