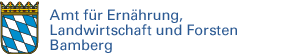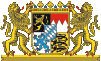Handlungsempfehlungen in geschwächten Kiefern-Wäldern
von Berit Kreibich
Langensendelbach – Zur offenen Waldberatung am Nachmittag des 26. Februars drehte sich alles um die Waldkiefer, umgangssprachliche auch Föhre genannt.
Das angestammte Verbreitungsgebiet der Föhre sind die nördlichen Gefilde. In unserer Heimat wird sie aufgrund ihrer Genügsamkeit auf den armen Sandböden seit Generationen gehegt. Sie ist sehr gut an Trockenheit und extreme Kälte angepasst. Sie hat jedoch ein Problem mit hohen Temperaturen, wie sie im Zuge der messbaren Klimaerwärmung immer häufiger werden.
Im Wald vor Ort wird vielerorts sichtbar, dass die Kiefern deutlich geschwächt sind. Braune Nadeln zeugen von einem Pilzbefall (Diplodia), große Misteln plagen die Baumkronen und die abfallende Rinde ist das Werk des blauen Kiefernprachtkäfers. Diese und noch viele andere Schädlinge befallen die Waldkiefer, wenn sie durch die heißen Sommer unter Stress gerät. Vor allem die Kombination aus verschiedenen Schadorganismen führt vielerorts zum Absterben der Kiefer.
Trotz Kälte und Dauernieselregen fanden sich mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Langensendelbach zum forstlichen Austausch ein. Der Zulauf übertraf damit alle Erwartungen. Sichtlich beeindruckt nahmen sich die Forstanwärterin Lina Nissl vom Forstrevier Neunkirchen und Florian Bonnekamp von der WBV Fränkische Schweiz e.V. der großen Schar an und zeigten in den betroffenen Waldstücken vor allem die Lösungen und Perspektiven.
Um die bestehende Konkurrenz in der Kiefern-Monokultur zu verringern, empfehlen Forstwissenschaftler und Praktiker maßvolle Durchforstungen und den Umbau zum Mischwald. Dabei werden vor allem stark geschwächte Bäume entnommen. Aber auch aus ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, die Kiefer grün zu ernten: Die WBV zeigte direkt vor Ort an einem durchgearbeiteten Bestand mit einer kurzen Rechnung, wie durch den Verkauf von Sägeholzanteilen deutlich höhere Erlöse als mit dürrem Brennholz erzielt werden konnten. Die individuelle Verwertung zwischen Eigenbedarf, Verkauf und die Frage nach dem richtigen Maß der Aufräumarbeiten wurden lebhaft diskutiert. Die Waldbesitzer wurden besonders sensibilisiert, dass abgestorbene Bäume hohe Risiken bei den Fällarbeiten mit sich bringen. Aber auch die Gefahren für Waldbesucher treiben die Eigentümer vermehrt um. Erkennbar abgestorbene Bäume hängen bedrohlich über der Forststraße und der betroffene Waldbesitzer trägt bei Unfällen ein Haftungsrisiko, wenn der angrenzende Weg gewidmet ist. Für die Aufarbeitung ist die sicherste Lösung ein Unternehmereinsatz, der durch die WBV begleitet wird. Die Erfahrung der Profis und der Aufbau der Forstmaschinen schützen Leib und Leben!
Vor Ort wurde der direkte Vergleich zwischen durchforstetem und unbehandeltem Kiefernwald deutlich. Durch das Auslichten entsteht ein Wald mit neuen Chancen. Geschützt vom lockeren Schirm gesunder Altkiefern können sich nun Jungbäume als hitzeverträglicher Mischbestand neu entwickeln. Die Forstverwaltung kann Flächen zur Wiederbestockung - ob gepflanzt oder natürlich entstanden - mit staatlichen Mitteln fördern. Waldbesitzer sollten unbedingt vor(!) Beginn der Arbeiten hierzu den kostenfreien Rat ihres örtlichen Forstreviers einholen.
Es war daher nur folgerichtig, dass auch Revierförster Daniel Schenk vom Forstrevier Neunkirchen a. Br. den Teilnehmern am Ende der Veranstaltung noch länger Rede und Antwort stand.
Vor-Ort Termine im eigenen Wald können bei WBV und Forstverwaltung während der jeweiligen Sprechzeiten individuell vereinbart werden.